Exkursion
zur Geschichte
der Stadtentwicklung – speziell der Gartenstadt
in
short.....
Die
Stadtentwicklung in der Geschichte des Deutschlands kennt spätestens
seit dem Mittelalter eine Reihe von Innovationsschüben und
Abstiegen. Ein erster großer Aufschwung lässt sich dabei im
Mittelalter erkennen. Sind es etwa im Jahre 1150
"zwischen Brügge und Wien, Schleswig und Genf"
etwa
200 Städte, trifft man in diesem Gebiet hundert Jahre später
schon auf etwa 1500, im Hochmittelalter sogar auf 5000 Städte.
Allerdings sind nicht alle mittelalterlichen Städte zugleich
auch Neugründungen. Viele Städte hatten ihre Ursprünge in
kleinen Siedlungen, die sich um eine Burg oder eine Abtei
gebildet hatten und auf eine lange Vergangenheit zurück
blicken konnten.
Im
15. Jahrhundert fand die mittelalterliche Stadtentwicklung
einen jähen Rückgang. Gründe hierfür waren schwerwiegende
Seuchen, Kriege und Agrarkrisen, die Deutschland heimsuchten
und ein Schwinden der Bevölkerung mit sich brachten. Nur
vereinzelt gründeten sich in Deutschland zu dieser Zeit neue
Städte. Einige waren religiös motiviert, wie die "Exulantenstädte",
die von protestantischen Flüchtlingen aus dem Ausland in
Deutschland erbaut wurden. In der Renaissance findet man in
Deutschland jedoch auch prächtige Fürstenstädte, die sich
das Versailles Ludwigs XIV. zum Vorbild nahmen.
Einen
weiteren Aufschwung konnte die deutsche Stadt erst wieder um
1870 mit Einsetzen der Industrialisierung verzeichnen. Erst zu
dieser Zeit kann man in Deutschland auch von einer wirklichen
Verstädterung der Bevölkerung sprechen.
Diese Arbeit wird sich im Folgenden mit den Bewegungen im Städtebau
zu jener Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Dabei
werden vor allem die Stadtentwicklungen in Berlin und im
Ruhrgebiet in hohem Maße eine Rolle spielen. Zudem wird zu klären
sein, weshalb sich eine Gartenstadtbewegung gründete, was
ihre Ziele waren und wie stark sie auf die deutsche Stadt
Einfluss nahm.
1.1.
Gründerzeitliche Stadtentwicklung
In
der Gründerzeit, die man zwischen 1871 bis 1873 fassen kann,
war in allen Bereichen ein Aufschwung zu bemerken. Nach der
langen Zeit, in der Deutschland in seinem Status als
Agrarstaat verharrt hatte, ermöglichte der rasende
Fortschritt in Wirtschaft, Medizin und Technik für
Deutschland eine grundlegende Umorientierung. Aus der
Agrargesellschaft wurde eine Industriegesellschaft mit all
ihren Folgen, und dies bedeutete auch eine grundlegende Veränderung
für die deutschen Städte, die an diesen Reformbewegungen
teil haben wollten.
Seit
der Erfindung der Dampfmaschine, des mechanischen Webstuhls
und neuer Transportsysteme wie der Eisenbahn erfolgte eine
technische Neuentdeckung nach der anderen, derer positiver
Beeinflussung der Wirtschaft sich auch der Agrarstaat
Deutschland nicht mehr verschließen konnte.
Technische Innovationen wurden sowohl zunehmend zur Gewinnung
billiger und neuer Rohstoffe wie z.B. Steinkohle genutzt, als
auch in traditionellen Bereichen wie in der Landwirtschaft und
zur Entwicklung bisheriger Industriebetriebe.
An Kapital mangelte es Unternehmen zu dieser Zeit nicht, wenn
sie sich der industriellen Revolution anschließen wollten.
Rund 5 Milliarden Francs (4 Milliarden Mark) erhielt
Deutschland nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 als
französische Kriegsentschädigung.
Dies war zudem eine Motivation für viele Jungunternehmer neue
gewerbliche und industrielle Unternehmen und
Aktiengesellschaften zu gründen. Dem wirtschaftlichen
Aufschwung in Deutschland stand daher eigentlich nichts mehr
im Wege. Den Fabrikanten fehlte es jedoch zunehmend an
Arbeitskräften für ihre Unternehmen in den Großstädten, da
um ca. 1871 noch etwa 63,9 % der Reichsbevölkerung in
Gemeinden am Land, also in Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern
wohnten.
Die Situation in den ländlichen Gebieten wurde für die Bevölkerung
jedoch immer unerträglicher, was einen Umzug in die
Industriestädte immer attraktiver werden ließ. Der
medizinische Fortschritt, die Verbesserung der
Lebensmittelversorgung und das Ende der Feudalherrschaft ließ
zwar die durchschnittliche Lebenserwartung von 35 Jahre auf 50
Jahre empor schnellen und somit die Bevölkerung rapide vergrößern.
Mit der Zeit konnten die ländlichen Gemeinden ihre stark
anwachsende Einwohnerschaft aber nicht mehr ernähren, was
dazu führte, dass ehemalige Bauern mit ihren Familien in großer
Zahl in die Städte strömten, um dort nach Arbeit in den
Fabriken zu suchen.
Besondere Anziehungspunkte waren dabei die neuen
Montanreviere, wie das Ruhrgebiet, aber auch Städte, die
wirtschaftlich bedeutende Verkehrsknotenpunkte im neuen
Eisenbahnnetz darstellten, wie z.B. Frankfurt, Hamburg und
nicht zuletzt Berlin.
Diese Gebiete wurden jedoch unausweichlich mit dem Problem der
immer gravierender werdenden Wohnungsnot konfrontiert. Schon
1890 findet man in vielen deutschen Großstädten eine drei
mal so große Bevölkerung wie noch 1870 vor.
Noch 1866 hatte man sich in der Berliner Vossischen Zeitung
nur vorsichtig mit dem Wohnungsmangel beschäftigt und eher
den Prestigegewinn einer bevorstehenden Vergrößerung Berlins
in den Vordergrund gestellt: "Berlin wird Weltstadt!
Die Bedeutung einer Hauptstadt steigt mit der Ausdehnung des
Staates in geometrischer Proportion; auch wenn wir bescheiden
genug sind, nicht mit London rivalisieren zu wollen, so können
wir doch, nachdem wir schon Wien und St. Petersburg überflügelt
haben, wohl daran denken, Paris noch einzuholen. Dass dies
nicht ohne Einfluss auf die Wohnungsverhältnisse bleiben
kann, liegt auf der Hand".
Bereits 1870 musste man sich dann allerdings eingestehen, dass
eine Wohnungsbaureform in Berlin unausweichlich war.
Von diesem Zeitpunkt an erfuhr die Bauwirtschaft in
Deutschland einen Höhepunkt. Anfangs hatte man noch die Möglichkeit
die Stadt dichter zu besiedeln, das bedeutete eine größere
Anzahl an Einwohnern auf gleichbleibender Fläche. Dies
erreichte z.B. die Stadt Berlin vor allem dadurch, dass sie
auf bisher unbebauten Flächen Häuser errichtete oder
vorhandene Gebäude durch größere und daher effektivere
ersetzte. Mit zunehmender Urbanisierung (zwischen 1871 und
1910 stieg die Bevölkerung in den Gemeinden über 100000
Einwohner um das Siebenfache) reichte jedoch der Platz
in der Stadt nicht mehr aus und die Städte waren gezwungen
ihr Gebiet zu erweitern. Dazu mussten jedoch erst einmal
vorhandene mittelalterliche Befestigungsanlagen entfernt
werden, die die Fläche der Stadt bisher eingegrenzt hatten.
Oftmals genügte es aber schon Wallanlagen in Promenaden
umzuwandeln oder durch Ringstraßen, wie den Wilhelminischen
Ring in Berlin, zu ersetzen. Da jedoch der Strom der
Einwanderer nicht abriss, sahen sich die Städte bald
gezwungen ihre alten Stadtgrenzen hinaus in das städtische
Umland zu verschieben. Das war unproblematisch, solange das
Umland Feldmark der Stadt war, also zum städtischen
Gemeindebezirk gehörte. Schwierig wurde es aber, wenn dies
nicht der Fall war und die Städte das Umland erst
eingemeinden mussten.
So erfolgte innerhalb der kurzen Zeit von fünf Jahren,
nachdem der alte Stadtkern Berlin Mitte, Prenzlauer Berg,
Friedrichshain, Kreuzberg, Tiergarten und Wedding zu 88,7% überbaut
war, eine sprunghafte Ausdehnung Berlins in seine
Nachbargemeinden. Berlin vergrößerte seine Fläche von 6586
ha auf 87810 ha, also mehr als das 13-fache.
Durch den Anstieg der Bevölkerung und der Vergrößerung der
Wohnfläche wurde es zunehmend unvermeidlich die Infrastruktur
in den Städten zu verbessern. Die städtische Hygiene z.B.
konnte aufgrund der Größe der Städte nicht mehr weiter
ignoriert werden. Daher wurde ab dem Jahr 1875 mit dem Bau
einer Kanalisation begonnen. Auch die Gewährleistung einer
Wasserversorgung aller Stadtbewohner war inzwischen
unverzichtbar geworden. Mit dem Aufkommen der ersten
Automobile und öffentlichen Verkehrsmittel begann man zudem
in den meisten Großstädten ein Straßennetz zu planen und
aufzubauen.
Neben der rapiden Entwicklung von Wohnungsbau und Industrie
war in der Gründerzeit in Berlin auch eine Hochkonjunktur im
Bau öffentlicher Gebäude zu beobachten. Vor allem der Staat
und seine Herrscher nutzten laut Schinz die aufwendige
Errichtung solcher Baudenkmäler zur ihrer Selbstdarstellung:
"Diese Prinzipien lagen allen öffentlichen Bauwerken,
vor allem aber den zahlreichen durch das Herrscherhaus geförderten
Kirchenbauten, zugrunde. In diese Reihe gehört der Dom, die
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche,
die Kaiserin-Augusta-Gedächtniskirche, die Gnadenkirche im
Invalidenpark, die Garnisonkirche am Südstern".
Aber auch eine Vielzahl kaiserlicher Denkmäler, Bahnhöfe,
Regierungs- und Gerichtsgebäude entstanden zu dieser Zahl.
In den vielen neuen Gebäuden, die während der Gründerzeit
entstanden, kann man jedoch keine einheitliche Architektur
beobachten. M.S. Cullen beschreibt dies so: "Einen Gründerzeitstil
gibt es nicht, ja gerade die Stillosigkeit ist typisch für
diese Zeit. Die Wiener Ringstraße zeigt dies deutlich. In der
etwa 30-jährigen Gründerzeit der Donaumonarchie von etwa
1860-1890 baute man in der Ringstraße eine gotische Kirche,
die Votivkirche, und ein gotisches Rathaus, ein
klassizistisches Parlamentsgebäude, zwei Museen im
Neo-Renaissancestil sowie ein Universitätsgebäude mit
deutlichen Anklängen an den französischen Barock".
Allerdings sind gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den neuen Gebäuden
zu entdecken, die sie als Gebäude der Gründerzeit
kennzeichnet. Sowohl der Berliner Reichstag, die Semper-Oper
in Dresden als auch der Frankfurter Hauptbahnhof mit in ihren
rundbogigen Fenstern und ihrer horizontalen Gliederung folgen
dem Vorbild der norditalienischen Renaissance.
Nur der Jugendstil, der allerdings schon 1910 sein Ende fand,
brach mit den zur Gründerzeit üblichen historischen
Stilzitaten aus Gotik und Barock und verwendete eine neuartige
Ornamentik. Vor allem fließende und geschwungene
Pflanzenmotive, die einen Gegenpol zu der naturverleugnenden
Stadt bilden sollten, wurden als Ornamente zur
Fassadengestaltung verwendet.
Der Jugendstil ist jedoch auch ein Wegebereiter der Moderne.
Zum Ersten Mal finden Materialien wie Stahl, Glas und Eisen
ihren Weg in die Architektur.
Für die vom Land kommenden zahlreichen Arbeitern und ihren
Familien mussten die Großstädte Wohnquartiere bereit
stellen, die schnell und billig zu bauen waren. Während der
Gründerzeit war es das Ziel der Baugesellschaften, vor allem
möglichst viele Leute auf einen engen Raum zu bekommen, da
die Fläche in den Städten sehr beschränkt war. Daher begann
man mit dem kostengünstigen Bau von Mehrfamilien-Mietshäusern
(Mietskasernen), die dicht zu Wohnblocks aneinandergereiht
wurden und mit vielen kleinen kargen Wohnungen ausgestattet
waren. Hauptsächlich in Berlin, wo am Wilhelminischen Ring
zahlreiche Mietskasernen entstanden, waren die Zustände in
den kleinen Arbeiterwohnungen verheerend. Die Belichtung und
Durchlüftung war aufgrund der engen kleinen Innenhöfe eher dürftig,
zudem ließen der hohe Lärmpegel und die mäßige sanitäre
Ausstattung (erst ab 1875 wurde eine Kanalisation, ab 1885
Wasserspülklosetts gebaut) die Mieter an ihre physischen und
psychischen Grenzen geraten. Zusätzlich wurden die
Bewohner durch hohe Mieten belastet, die sich durch die ständige
Flut von Wohnungsinteressenten vom Land ergaben. Daher waren
die meisten Familien gezwungen Untermieter und Schlafgänger
in ihren Wohnungen aufzunehmen. Eine Volkszählung in Berlin
von 1861 brachte bedenkliche Zustände zutage. "Damals
lebten 48326 Menschen, ein Zehntel der damaligen Berliner
Einwohner, in Kellerwohnungen. Von 105811 Berliner Wohnungen
insgesamt hatten 51909 nur ein heizbares Zimmer. Weit über
ein Fünftel der Berliner Bevölkerung teilte ein heizbares
Zimmer mit mindestens 5 Personen".
Die Wohnungsreformer zu der Zeit schrien sowohl laut auf über
die moralischen Verderbnisse, die das enge Zusammenleben von
vielen Menschen verschiedenen Geschlechts mit sich brachten,
als auch über die gesundheitlichen Gefährdungen, denen die
Mietskasernenbewohner ausgeliefert waren.
Allerdings schien die dicht gedrängte Mietskasernenbauweise die
beste Möglichkeit zu sein, die in Massen einströmenden
Arbeitssuchenden in den Großstädten unterzubringen. Zudem
gab es noch weitere Faktoren, die den
Mehrfamilien-Mietshausbau z.B. in Berlin begünstigten. Zum
Einen suchte Berlin einen Weg, den Mangel an Platz, der in der
Stadt vorherrschte, zu umgehen. Denn bevor das Umland
eingemeindet werden konnte, musste man Grundstücke, die in
privater Hand waren, erwerben. Zunächst einmal beschloss man
jedoch das kleine Stadtgebiet erst einmal vollständig
auszunutzen. Weitere Stadterweiterungen wurden zu jener Zeit
von privaten Terraingesellschaften durchgeführt, die die
Gebiete erst kauften und dann in baufertige Flächen
umwandelten. Danach wurden die Grundstücke an die mit den
Terraingesellschaften verbundenen Baugesellschaften übergeben.
Auf diesen Flächen entstanden daraufhin Straßen und Mietshäuser.
Diese von den Banken unterstützte Bau- und Bodenspekulation
war mit hohen Investitionskosten und einem erheblichen Risiko,
fehlinvestiert zu haben, verbunden.
Zudem förderten die in Deutschland geltenden unzureichenden
Bestimmungen wie die Baupolizeiordnungen, die auf dem
Allgemeinen Landrecht von 1794 basierten, die Stadterweiterung
Berlins durch Mietskasernen. Diese Bestimmungen legten den
Aufriss fest, also Gebäudeabstand, -höhe, -nutzung und
dergleichen. Die von den staatlichen Polizeibehörden
erlassenen Ordnungen schränkten die Baufreiheit der
Bodeneigentümer in nur vier wesentlichen Punkten ein, die
sich nur auf die Konstruktionssicherheit der Gebäude, auf die
öffentliche Sicherheit der Straßen, auf das Verbot der
Verunstaltung des Stadtbildes und die Feuersicherheit der
Mietskasernen bezogen.
So wurde z.B. festgesetzt, dass die Mindestgröße der
umbauten Innenhöfe 5,30m mal 5,30m groß sein musste, also
der Größe eines aufgespannten Feuerwehrsprungtuches
entsprechen mussten.
Daher wurde oftmals, um die Flächen so effektiv wie möglich
auszunutzen, an die Vorderbauten noch zusätzlich Seitenflügel
und Quergebäude angebracht, die die kleinen Innenhöfe eng
umschlossen.
Weitere Gründe für den Bau von Mietskasernen ergaben sich
allerdings auch aus der vorherrschenden Wohntradition in Großstädten.
Da die oberen Schichten in den Industriestädten meist auch in
herrschaftlichen und großbürgerlichen Wohnungen lebten,
zogen die Arbeiterfamilien, von diesem Vorbild beeinflusst,
auch nur zu gerne in die Mehrfamilien-Mietshäuser.
Eine große Rolle spielte zusätzlich der gering ausgebaute öffentliche
Nahverkehr, der es unmöglich machte, Arbeitsstätte und
Wohnstätte der zugezogenen Menschen allzu weit voneinander zu
entfernen. Dieses Problem machte es erforderlich Wohnplätze
in der Nähe der Arbeitsstellen zu schaffen, was oftmals zu
einer Durchmischung der Wohn- und Gewerbefunktionen wie im
Wilhelminischen Wohn- und Gewerbegürtel in Berlin führte.
Während der Gründerzeit konnte man in den Industriestädten
durchaus eine Planung der topographischen Entwicklung
beobachten. Zwar darf man diese Konzeptionsversuche nicht mit
der heutigen Stadtplanung vergleichen. Allerdings kann man zu
Anfang des 19. Jahrhunderts eine Strategie in den deutschen Städten
erkennen, die man in Großbritannien zu der Zeit stark
vermisste. So entwickelte der Baurat James Hobrecht 1862 in
Berlin zusammen mit den Kommunalbehörden und dem Polizeipräsidium
einen Generalbebauungsplan, der sich vor allem mit dem Straßengrundriss
der Industriestadt beschäftigte.
Sein großes Vorbild hierbei war der Präfekt des Departement
Seine von Paris, Haussmann, der moderne,
verkehrsorientierte Straßenbaumaßnahmen durchführte. Von
ihm übernahm Hobrecht die Idee von Diagonalstraßenverbindungen,
die vor allem wichtige öffentliche Gebäude und Plätze
miteinander verbanden, die Anlage breiter Boulevards sowie
sternförmiger Straßenkreuzungen (Sternplätze).
Zusammen mit den Berliner Bauordnungen, wie der
Baupolizeiordnung, schuf der Generalbebauungsplan von Hobrecht
die besten Voraussetzungen für die Entwicklung hin zum noch
heute sichtbaren Mietskasernenbau.
Für die gehobeneren Schichten der Gesellschaft wurden während
der Gründerzeit in Berlin natürlich auch neue Gebäude
errichtet, die sich in ihrer Größe und in ihrem Stil
wesentlich von den Mietskasernen unterschieden. Bei diesen Großvillen
(für eine Familie) oder auch bei den Mietvillen
(Mehrfamilienhäuser) war es typisch, dass sie nicht in der Nähe
der Industrienanlagen und engen Verhältnisse Alt-Berlins oder
des Wilhelminischen Ringes zu finden waren, sondern außerhalb
Berlins, wie z.B. in Lichterfelde oder Tegel, an den ab 1868
entstandenen Haltestellen des Vorort-Bahnverkehrs oder an den
Straßen, um dennoch schnell in die Innenstadt gelangen zu können.
Zudem entstanden Villensiedlungen auch teilweise an den um
Berlin gelegenen Gewässern, was der Erholung der höheren
Einkommensschichten diente
.
Doch nicht nur die Stadt Berlin erfuhr während der Mitte des 19.
Jahrhunderts eine weitreichende Entwicklung aufgrund des
rasanten Fortschritts in Technik und Forschung, auch die Städte
im Ruhrgebiet veränderten ihr Stadtbild in der
Industrialisierung grundlegend. Viele Dorfbewohner fühlten
sich zu der Zeit angezogen von den vielen Zechen und Fabriken,
in denen Ressourcen durch die Erfindung neuer Maschinen
schneller und in größeren Massen gefördert und verarbeitet
werden konnten. Unter diesen enormen Einwohnerzahlen und dem
stetig wachsenden Gewerbe wandelte sich im Ruhrgebiet im
Gegensatz zu Berlin jedoch nicht nur eine Stadt, sondern es
entwickelten sich sogar ganze Städtelandschaften.
Zur Unterbringung der Arbeitssuchenden und ihrer Familie
entstanden in dem rohstoffreichen Gebiet etwa ab 1844
Werkskolonien, die von den jeweiligen Werken wie dem Bergbau
(Zechenkolonien) oder auch anderen Industriezweigen wie den Hüttenwerken
finanziert wurden. Für die Arbeiter schien die Aussicht auf
eine Arbeit mit verbundener Wohnstätte ein verlockender Grund
zu sein ihre Dörfer zu verlassen. Allerdings waren die
Mietverträge auch stets mit den Arbeitsverträgen verbunden,
was zwar einen ständigen Wechsel der Betriebsangehörigen
verhinderte und auch auswärtige Arbeiter reizte, aber auch
eine Abhängigkeit der Belegschaft von ihrem Werk begünstigte.
Zudem erschienen diese Kolonien zwar als eine soziale Fürsorge
des Unternehmers für seine Arbeiter, die enge Verbundenheit
zwischen Wohnung und Arbeitsstelle entwickelte allerdings eine
sehr einseitige Sozialstruktur, die keinen Kontakt zu Menschen
anderer Berufe oder Schichten ermöglichte.
Herausragend ist jedoch für die Mietshäuser im Ruhrgebiet,
dass sie im Gegensatz zu den Wohnungen in den anderen
Industriestädten Deutschlands mit Ställen und Hausgärten
ausgestattet wurden, was die Anpassung der ehemaligen
Landbewohner an das städtische Leben ermöglichte.
Oftmals konnte man so während der Industrialisierung
Werkskolonien mit Gärten entdecken, die sich wie selbstverständlich
neben den modernen Industrienanlagen ansiedelten.
Die Unterschiede, die in der Gestalt der Werkskolonien zu
erkennen sind, lassen darauf schließen, dass sich die
Kolonien in gewissen Zeitabständen zu anderen Baustils
hinentwickelt haben. Zu Anfangs nahm man insbesondere die
englische Arbeiterwohnung zum Vorbild und errichtete ein- bis
anderthalb geschossige langgestreckte Reihenhäuser von
100-200 m Länge wie in der Kolonie Am Holzgraben in
Dortmund-Scharnhorst, die im Volksmund auch D-Züge genannt
wurden
Ab ca. 1850 bis ca. 1870 entschieden sich die Werke für
gereihte Einzelhäuser für zwei bis vier Familien . Es
entstanden in der Zeit kleine Kolonien mit Häusern aus
Backstein, die der Tradition der Landhäuser nachfolgten. Man
ordnete dabei die Gebäude streng linear an und bevorzugte für
die Form meist geometrische Strukturen. In der Bauperiode ab
1871 errichtete man aufgrund der starken Wohnungsnachfrage größere
Siedlungen, die kleiner Abstände zueinander hatten und höhere
Stockwerkzahlen (in der Regel zweigeschossig) aufwiesen.
In der 3. Konjunkturphase von ca. 1890-1900 war man mit der
bisherigen Gestaltung der Kolonien nicht mehr zufrieden und
entschied sich daher für eine Mischung von Form und Farbe der
Gebäude, so dass "durch den Wechsel von bisweilen 15
verschiedenen Grundriss- und Aufrisstypen" ein
"wechselvolles Straßenbild"
entstand. Nach 1900 bis ca. 1905/06 stieg die
Wohnungsnachfrage so rapid, dass die neuen Koloniehäuser nur
noch mit 2½- bis 3½ Geschossen gebaut wurden.
Ab 1905 dann entstand vor allem bei Krupp ein Widerstand gegen
die oftmals zu eintönigen Werkskolonien und man errichtete
fast gartenstadtähnliche Zechenkolonien mit
"gestalterisch absprechenden wechselwirksamen Straßenbildern
und Platzanlagen".
Diese Bauweise wurde bis ca. 1926 fortgesetzt, ab dann baute
man zunehmend 3- bis 4- geschossige Mehrfamilienhäuser mit
kleineren Wohneinheiten. Ab etwa 1920 wechselte der
Wohnungsbau im Ruhrgebiet über zu genossenschaftlichen oder
gemeinnützigen staatlichen Einrichtungen.
Mietskasernen und Werkskolonien schienen während der Gründerzeit
in den Industriestädten die besten Mittel zu sein die rasant
wachsende Zahl von Arbeitsuchenden vom Lande billig und
schnell mit Wohnstätten zu versorgen. Mit der Zeit wurde man
sich jedoch bewusst, dass Reformen in den Städten nötig
waren, um soziale, hygienische und menschliche Missstände,
die sich zunehmend als Begleiterscheinungen der neuen Wohnform
erkennbar machten, auszumerzen. Ebenezer Howard, der sich mit
dem durch die Bevölkerungsexplosion in den englischen Großstädten
einsetzenden Chaos beschäftigte, formulierte dies so:
"Der Städtebau - als ein auf Denken und Planmäßigkeit
beruhendes Unternehmen - ist eine vergessene Kunst, wenigstens
in unserem Land, und diese Kunst muss nicht nur neu belebt,
sondern auch von höheren Idealen getragen werden, als man
sich bisher träumen ließ".
Howard entwickelte daher ein neuartige moderne Stadtform, die
auch in dem von unwirtlichem Mietshausbau geplagten
Deutschland bald Anklang fand.
Nachdem sich der Brite Ebenzer Howard jahrelang mit den Folgen
des ungegliederten Städtewachstums Mietwucher, Armut,
Bodenwertsteigerung, hygienische Probleme auseinander gesetzt
hatte, forderte er ein neues Stadtmodell, das auf den
sozialreformerischen Ideen verschiedener Autoren basierte. Er entwickelte dabei ein
Konzept, das er "Garden Cities" (Gartenstädte)
nannte. In seinem Gartenstadtmodell geht er von einer
Zentralstadt aus, um die sich in einem gewissen Abstand
mehrere kreisförmige Gartenstädte gruppieren sollten. Sollte
ein Überschreiten der maximalen Einwohnerzahl von 250 000
Einwohner in der Zentralstadt drohen, sollten die
Wohnungssuchenden in die Gartenstädte ausgelagert werden, für
die eine ungefähre Einwohnergrenze von 32000 Einwohner
festgesetzt worden war. Zwischen der zentralen Großstadt und
ihren Gartenstädten sollte sich laut Howard ein Grüngürtel
befinden, der mit unbebauten Flächen, landwirtschaftlich
genutzten Gebieten, Gärten und Parks ausgestattet werden
sollte, um den Familien in der Großstadt und in den Gartenstädten
ein freundliches lebenswertes Umfeld zu bieten und sie zudem
mit selbst hergestellten landwirtschaftlichen Produkten
versorgen zu können. Zusätzlich sollte eine möglichst
geringe Dichte in den Gartenstädten (12 Häuser pro acre,
d.h. 0,4 ha) und ein guter Anschluss zur Zentralstadt durch
Eisenbahnverbindungen und zu den Nachbarstädten durch
tangential verlaufende Eisenbahnschienen und Radialstraßen
einen komfortablen Wohnstil gewährleisten.
Die Gartenstadt an sich sollte eine eigene an den
Eisenbahnschienen befindliche Industrie vorweisen können, um
ihren Einwohnern zwar einerseits Arbeitsplätze aber auch
andererseits ruhig gelegene Wohnungen bieten zu können.
Geringe Monatsmieten und Zinsbelastungen, die durch das
Festschreiben des Bodenpreises gefördert wurden, sollten die
Leute zusätzlich in die Gartenstädte locken.
Aber auch mit eigenen Einrichtungen für Kultur und Bildung
wie z.B. Schulen, Museen und Theatern sollte die Gartenstadt
nicht sparen, damit sie sich eine gewisse Unabhängigkeit von
der Großstadt erhalten könnte.
Eine
weitere räumliche Ausdehnung als die geplante sollte die
Gartenstadt jedoch nicht erfahren. Als Alternative waren, nach
Howard, Tochtergründungen der Gartenstadt denkbar, die
allerdings von weiteren Grüngürteln voneinander getrennt
sein sollten. Als wesentliche Idee Ebenzer Howards kann
ebenfalls die Finanzierung der Gartenstadt verstanden werden.
Die komplette Gartenstadt sollte in den Besitz von
Genossenschaften und der Öffentlichkeit übergehen, wobei
"Überschüsse aus den [...] Bodenrenten der Schaffung
und Instandsetzung der Infrastruktur (Straßen, Schulen etc.)
dienen sollten".
Ebenezer Howard fasste 1898 seine Überlegungen in einem Buch
"Garden Cities of Tomorrow" zusammen, welches es
schaffte seine Idee des Gartenstadtmodells in der ganzen Welt
zu verbreiten.
Darin bot er auch eine kurze persönliche Definition der
Gartenstadt: "Eine Gartenstadt ist eine Stadt, die für
gesundes Leben und für Arbeit geplant ist; groß genug, um
ein volles gesellschaftliches Leben zu ermöglichen, aber
nicht größer; umgeben von einem Gürtel offenen
(landwirtschaftlich genutzten) Landes; die Böden des gesamten
Stadtgebietes befinden sich in öffentlicher Hand oder werden
von einer Gesellschaft für die Gemeinschaft der Einwohner
verwaltet". Er
schuf eine Vision eines neuen Typs von einer geplanten
Stadt. Sie sollte den Vorteil eines Landlebens mit dem Komfort
der Stadt kombinieren. Er kreierte die Theorie der „Three
Magnets“. Drei Magneten repräsentierten Stadt, Land und die
Stadt-Land-Kombination.
Die
Stadt hatte für ihn untere anderem Eigenschaften wie „social
opportunity“, aber auch „isolation of crowds, „high
money wages“, aber auch „high rents and prices“, zwar
„chances of employment“, aber auch eine „army of
unemployed“. Ähnlich zwiespältig war für Howard das
Landleben: Hier gab es zwar die „beauty of nature“, „fresh
air, low rents“, aber auch „long hours, low wages“ bei
der Arbeit, einen „lack of society“ und „no public
spirit“.
|
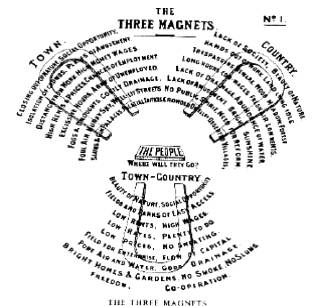
Drei
Magneten
|
Die
Lösung sollte beides in einem sein, der dritte Magnet:
Howards „garden city“ sollte eine Stadt ohne einen Slum
sein, in der die Menschen in einer ansprechenden Umwelt leben
und arbeiten konnten. Praktisch unabhängig, verwaltet und
finanziert von den Bürgern, die ein ökonomisches Interesse
in der Stadt hatten, sollte sie gebaut und anschließend geführt
werden zum Wohle der ganzen Gemeinde.
Howards
Vision wurde Realität: "Tomorrow" wurde 1898 veröffentlicht.
1899 wurde die „Garden City Association“ gegründet. 1902
erschien bereits die Neuauflage seines Buches unter dem Titel
„Garden Cities of Tomorrow". 1903 begann man nach Entwürfen
von B. Parker und R. Unwin mit der Anlage von Letchworth, die
bereits nach dem ersten Weltkrieg die Trabantenstädte
Englands direkt beeinflusste.
Zwar waren nicht alle von Howards Ideen vollständig neu, schon
einige vor ihn hatten ähnliche Überlegungen formuliert,
seine Darstellung des "Gartenstadtmodells"
begeisterte und überzeugte allerdings viele im Städtebau tätige
Zeitgenossen.
Im Jahr 1903 wurde dann in der Nähe von London mit der
Organisation und Vorbereitung der ersten Gartenstadt bei
Letchworth begonnen. Bei den primären Planungsversuchen
stellte sich jedoch heraus, dass man den Angaben und
Diagrammen Howards nicht einfach folgen konnte wie erwartet.
Man einigte sich daher auf gewisse Einschränkungen des
Gartenstadtmodells. Da örtliche Gegebenheiten mit berücksichtigt
werden mussten, errichtete man eine quer durch das Gebiet führende
Bahnlinie und behielt eine größere Grünfläche als von
Howard vorgeschrieben bei. Zwar konnte die von Howard
vorgesehene Gartenstadtdichte eingehalten werden, Letchworth
entwickelte sich allerdings nur sehr langsam und stetig, so
dass die erste Gartenstadt 20000 Einwohner erst 1950 aufweisen
konnte.
In der Folgezeit versuchte jedoch niemand dem Vorbild
Letchworth zu folgen. Howard war so enttäuscht darüber, dass
er mit einer kleinen Gruppe von Anhänger im Jahr 1919 den Bau
der 35 km von London entfernten Gartenstadt Welwyn zu
organisieren begann. Man strengte sich an, mit Welwyn dem
Ideal des Gartenstadtmodells näher zu kommen als mit
Letchworth, doch es konnten wiederum nur manche der
Gestaltungsprinzipien eingehalten werden.
Nach Fertigstellung der Gartenstadt Welwyn kam es zu keiner
weiteren Umsetzung des Garden-City-Konzepts. Die Idee des
Gartenstadtmodells von Ebenezer Howard war viel zu
idealistisch, zu umfangreich und zu theoretisch gewesen, als
das es wirklich nach seiner Vorstellung verwirklicht hätte
werden können. Posener versuchte das grundsätzliche
Scheitern des Gartenstadtmodells näher zu erläutern:
"Sie hat es
nicht geschaffen. HOWARDS Hoffnung, dass einige Beispiele eine
Kettenreaktion auslösen würden, welche die Struktur Englands
und, wer weiß, der Welt verändern würde - a Peaceful Path
to Real Reform, wie der Untertitel seines Buches sagt - hat
sich nicht erfüllt. Die Frage, warum, ist vielleicht nicht müßig;
aber ihre Antwort könnte nur nach einer tiefen und
eingehenden Analyse der Geschichte dieses Jahrhunderts gegeben
werden. Es mag etwas damit zu tun haben, dass HOWARD den
Landmagneten zu groß gezeichnet hat. Vertreter des
Gartenstadtgedankens werden sagen, dass die Menschen partout
nicht einsehen wollen, wo für sie das gute Land liegt. Gegner
der Gartenstadtbewegung werden genau das gleiche sagen. Sie
unterscheiden sich voneinander erst, dass sie es einsehen müssen,
da es keine echte Alternative gebe, und dass sie es mithin
einsehen werden, während der andere meint, sie würden es nie
einsehen, der Gedanke selbst sei falsch".
Ebenezer Howard starb bereits 1928 in seiner Gartenstadt Welwyn.
Vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckte man
seine Idee des Gartenstadtprinzips neu und errichtete
gartenstadtähnliche Wohnsiedlungen, allerdings ohne
Gartenstadtkonzeption.
Es dauerte nicht lange bis Ebenezer Howards Gedanke der
Gartenstadt auch in Deutschland Gehör fand. Dort hatten sich
zwar auch schon unabhängig von Howard verschiedene
Zeitgenossen wie Theodor Fritsch mit ähnlichen Städtereformen
in deutschen Industriestädten beschäftigt, dieser setzte
allerdings zudem großen Wert auf ideologische Faktoren, was
die deutsche Gartenstadtbewegung im Besonderen prägen sollte.
Nachdem in Deutschland die Stimmen nach Wohnungs- und
Sozialreformen immer lauter wurden, schlossen sich im Jahr
1902 Anhänger zu der Deutschen Gartenstadtgesellschaft
zusammen, deren Zielsetzung im §1 ihrer Satzung festgehalten
wurde: "Das Ziel der Gartenstadtgesellschaft ist die
Gewinnung breiter Volkskreise für den Gedanken der Errichtung
von Gartenstädten auf der Grundlage des Gemeineigentums am
Stadt- und Landboden, sowie die Förderung aller Maßnahmen,
die diesem Ziele dienen".
Nach der Gründung wurde die Gartenstadtgesellschaft sehr
aktiv und überlegte sich schon bald Möglichkeiten zur
konkreten Umsetzung ihrer Ideen. So versuchte man vor allem an
die im Jahr 1905 erfolgreich gegründeten
gartenstadtbeeinflussten Werkskolonien im Ruhrgebiet wie die
Wohnsiedlung Margarethenhöhe in Essen oder die Zechenkolonie
Teutoburgia in Herne anzuschließen. Die erste
aussichtsreiche Gartenstadtgründung der Gesellschaft erfolgte
1906 in Dresden. Ab diesem Zeitpunkt bis zu Beginn des Ersten
Weltkriegs wurde eine Vielzahl an Gartenstädten realisiert,
die allerdings nie vollständig den Vorstellungen Ebenezer
Howards entsprachen.
Ausschließlich entstanden unter der Gartenstadtgesellschaft
Villensiedlungen und gartenumgebende Kleinhausansiedlungen am
Stadtrand, die mit dem Gartenstadtmodell Ebenezer Howards
lediglich wenig gemein hatten. Vor allem wiesen die meisten
gartenstadtähnlichen Siedlungen in den Stadtrandzonen weder
eine eigene Selbstverwaltung und eigene Versorgungszentren
noch städtisches Leben auf, was Howard für sein Modell immer
gefordert hatte. Das beste Beispiel dieser Umorientierung ist
die Siedlung Frohnau im Norden Westberlins, die 1908 als
durchgrünter Villenvorort für gehobenere
Gesellschaftsschichten gebaut wurde.
Aber sie blieb nicht das einzige Beispiel einer
Gartenstadtanlage in Berlin.
Mit
der Gründung der „Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft
1892“ hatte die Gartenstadtidee in Berlin Fuß gefasst.
Auch
hier sollten kooperative Arbeits - und Lebensformen an die
Stelle egoistischen und profitorientierten Denkens treten.
Alte ästhetischen Ideale waren überholt. Jetzt sollte der
bauliche Organismus mit dem sozialen Organismus in
harmonischer Gemeinschaft stehen.
1912
erwarb die „Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft
1892“, oft auch nur „1892“
genannt, das Areal am Falkenberg. Der Architekt Bruno Taut
entwarf den Plan
einer kleinen Vorstadt, von der zwischen 1913 und 1915 nur die
Bauten am sog. „Akazienhof“ und entlang des
Gartenstadtweges realisiert wurden. In dem Gesamtplan reihten
sich Quartiere mit zweigeschossigen Zeilen aneinander - gleich
englischen Reihenhäusern -, die im Rhythmus der ansteigenden Topographie gestaffelt wurden.
Aufgrund
wirtschaftlicher Probleme und dem Beginn des Ersten
Weltkrieges wurden statt der geplanten 1500 Wohnungen nur
einige verwirklicht. 1919 musste vor allem wegen ökonomischer
Probleme die Gartenstadt mit dem Spar- und Bauverein Berlin
fusionieren. Das komplette Projekt wurde nie verwirklicht.
Das,
was entstand, stellt sich auch heute noch wie folgt dar :
Der
sogenannte Akazienhof bildet einen aus der englischen
Gartenstadt tradierten Wohnhof. Das Charakteristische ist
hierbei, dass die Anlage eine Sackgasse bildet, d.h. es gib
keinerlei Durchgangsverkehr, der das Leben stört. Zur
Erbauungszeit war dies nicht so wichtig, heute kann dies als
„kommunikationsfördernde“ Planungsleistung gelten. Die
Straße bildet somit keinerlei größeren Gefahrenmoment, sie
ist vielmehr durch Baumbepflanzung und Vorgartenkultur belebt,
eine halböffentliche Erweiterung des individuellen
Wohnraumes. Dies wird nur deshalb erreicht, weil die
Stockwerkzahl an die Geländeform angepasst ist und die
Hauskulisse in einem Gefüge mit den angrenzenden Hauskörpern
steht. Eine banale Anordnung von beliebigen Einzelhäusern
bietet einen solchen geschlossenen Charakter nicht.
Es
wurde verschiedene Grundrisse und Haustypen erdacht, die
unterschiedlich kombiniert ein individuelles wohnen ermöglichen
sollten. Die Form der Gebäude sollte schlicht sein. Die
architektonischen Grundsätze plädierten für das einfache
Rechteck als Umriss des Grundrisses, ebenso für einen
einfachen Umriss des Aufbaus. Türme und dergleichen wurden
grundsätzlich ausgeschlossen. Man wandte sich gegen jede
komplizierte Dachform, ein Mansardendach galt als
unwirtschaftlich.
Erst
in einer weiteren Bauphase wurde das Prinzip der Einfachheit
gelockert und Häuser wurden mit vorsichtigen Ornamenten (Lattenspalierornamentik)
geschmückt und jetzt konnte man selbst verschieden farbige
geometrische Putzornamente finden.
Es
blieb aber bei der grundsätzlichen Absage an irrationale,
emotionale, historisierende Formen, der zuvor oft gesehenen Überschwänglichkeit
und damit die Hinwendung zur einfachen primitiven Form. Das
Formal Neue sollte das Sozialneue manifestieren.
Die
Aufteilung des Einfamilienhauses des sog. Typs III sah wie
folgt aus :
Im
Erdgeschoss befand sich das Wohnzimmer, die Küche mit
Speisekammer, eine Spülküche und die nach dem Garten hin zu
einer offenen Laube erweiterte Loggia .
Das
Obergeschoss wies zwei Zimmer , eine Kammer für ein Bett und
das Bad mit Klosett auf. Eine Dachkammer und ein großzügiger
Bodenraum sollten das Raumangebot abrunden.
Doch
gab es wie erwähnt mehre Häusertypen und die Mieter hatten
ein Mitbestimmungsrecht: Nicht nur die Planung und
Projektierung der verschiedenen Bautypen, auch die Ermittlung
und Klärung der Bewohnerwünsche wurde in Versammlungen an
Hand von Plänen diskutiert.
In
der Gestaltung der Gartenstadt kam besonders die bereits von
den Expressionisten erhobene Forderung nach farbiger
Gestaltung der Wohnungen und Häuser zum Tragen. So schrieb
1913 der Architekturkritiker Adolf Behne: „Die Typen- und
Reihenhäuser werden durch die wechselnde Farbgebung
individualisiert. Die Gefahr der Uniformität wird durch das
Hilfsmittel der Farbe sehr glücklich beseitigt. Bruno Taut
hat in Falkenberg den Versuch gemacht, die Farbe in den Dienst
der Gartenstadtarchitektur zu stellen.“

Tuschkastenfarben
in Falkenberg
Was
zu damaliger Zeit noch ein Kuriosum war, sollte nach 1918 die
gesamte Architektur beeinflussen. Die Farben, die Taut
anwendete, waren außer Weiß ein helles Rot, ein Olivgrün,
ein kräftiges Blau sowie ein helles Gelbbraun.
Zudem
wechselte bei den Reihenhäusern
im allgemeinen ein helleres Haus mit einem dunkleren. Die
Farbe der Häuser erhielt ihre volle Kraft erst durch den weißen
Anstrich der Fensterrahmen, Fensterkreuze und Fensterläden,
der Gesimse und der hölzernen Balkonbrüstungen, während die
Türen und Spaliere zumeist einen dunkleren Ton trugen. Weiß
waren dann wieder die Schornsteine und die Lauben. Stallgebäude
bekamen wieder einen dunkleren Anstrich. Der Name
„Tuschkastensiedlung“ lag auf der Hand.
Einige weitere wichtige Gestaltungsmerkmale von Howards
Gartenstadtmodell lieferten jedoch auch für die ausschließlich
mit Mietskasernen bebauten deutschen Industriestädte
entscheidende Anstöße zur Veränderung. Hervorzuheben sind
dabei vornehmlich Offenheit und Durchgrünung der Städte,
Planmäßigkeit der Wohnsiedlungen und die räumliche
Separation wichtiger Funktionen wie Wohnen, Sich-Erholen und
Arbeiten.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen verzichtete man
endlich auf die veralteten und unzureichenden Straßenfluchtlinienpläne
und Baupolizeiordnungen, die während der Gründerzeit die
Bebauung in so großen Industriestädten wie Berlin geregelt
hatten und ging über zu moderneren effizienteren Plänen wie
dem preußische Wohnungsbaugesetz von 1918, das sowohl die
Trennung von Gewerbe- und Wohngebieten als auch das Verbot der
Angliederung störender Industrie an bestimmten Gemeindeteilen
vorschrieb. Damit war der erste Grundstein zur modernen
Bauleitplanung
gelegt.
1933 fand in Athen ein internationaler Städtebaukongress statt,
zu dessen Gelegenheit sich berühmte Architekten wie Le
Corbusier trafen, um über ein neues Konzept der Stadt
nachzudenken. Dabei entstand ein Manifest mit einem
wegweisenden Thesenkatalog, der in etwa 95 Leitsätze zum Städtebau
gegliedert war. Von den vier Fassungen, die damals entstanden,
hat Le Corbusier 1941 eine herausgegeben. Zum Einen soll sich
diese Charta mit der Trennung der vier Funktionen Wohnen,
Arbeiten, Freizeit und Verkehr, die schon Ebenezer Howard in
seinem Gartenstadtmodell gefordert hatte, beschäftigt haben,
was jedoch von Einigen bezweifelt wird.
Zum Anderen machten die Städtebauer unter anderem auch
folgende Aussagen über die Stadtentwicklung:
1. Stadtentwicklung hängt von ökonomischen Faktoren ab.
2. Bisherige Wohnungen führten zur Ausbeutung
Wohnungssuchender, wurden parteiisch verteilt und verfügten
über geringe Freifläche.
3. Städte nahmen durch die Interessen mancher Privatpersonen
chaotischen Charakter an.
4. starke Mobilität der Arbeitsbevölkerung wurde durch
Funktionstrennung erzeugt u.s.w.
Sie hängten an diesen Thesenkatalog jedoch auch zahlreiche
Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung der Stadt an:
1. Die Stadt muss individuelle Freiheit für jeden gewährleisten.
2. Die Wohnung soll das Zentrum der Stadt werden.
3. Der Arbeitsplatz darf nur eine geringe Distanz zur
Arbeitsstelle aufweisen.
4. Bodenspekulation soll vermieden werden u.s.w.
Diese Aussagen kann man in ähnlicher Form schon in Ebenezer
Howards Buch von 1889 nachlesen.
Vor allem wurden jedoch die von den Städtebauern entworfenen
zweifelhaften Ideen der großräumigen Funktionstrennung nach
Kriegsende aufgegriffen, was häufig zu einer starren
Einteilung von Funktion und Fläche geführt hat und die
Kritiker der Charta dazu geführt hat, ihr die Schuld an der
"Zerstörung der städtischen Umwelt"
zu geben.
Allerdings findet man Spuren dieser Forderung nach Trennung
der vier Funktionen auch in dem Bundesbaugesetz der
Bundesrepublik Deutschland von 1960 wieder.
Die Gründerzeit blieb weitestgehend ein Phänomen. Noch nie in
der Geschichte waren in so kurzer Zeit so zahlreiche
technische und medizinische Fortschritte zu beobachten gewesen
wie Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Städte wie
Berlin entwickelten sich rasch zu industriellen Großstädten
mit Infrastruktur, die zudem noch eine Vielzahl an außergewöhnlichen
Baudenkmälern vorweisen können. Kleine Manufakturen im
Ruhrgebiet wandelten sich während der industriellen
Revolution zu Zechenanlagen mit enormen Ausmaßen wie sie nie
zuvor in Deutschland zu sehen gewesen waren.
Aber der rapide Wachstum in Deutschlands Städten zeigte auch
bald negative Auswüchse: Dicht gedrängte, dunkle
Mietskasernen z.B. in Berlin, in denen die Bewohner mit
hygienischer, räumlicher und gesundheitlicher Not zu kämpfen
hatten, wie außerdem sterile Werkskolonien im Ruhrgebiet, in
denen die Bergarbeiter mit ihren Familien zu Abhängigen ihrer
Arbeitgeber wurden.
Ein Wandel zu freundlichem, unabhängigen und offenen Wohnen
in durchgrünter Umgebung bot zwar die Idee des
Gartenstadtmodells von Ebenezer Howard. Doch bei dem Versuch
der praktischen Umsetzung seines Modells, wurden die Städtebauer
schnell in ihre Grenzen gewiesen, was bewies, dass das
Gartenstadtmodell zu idealistisch war, um realisiert zu
werden.
2. Vorüberlegungen
„Die
Exkursion ist eine handlungs- und erfahrungsorientierte Form
des Lernens. Sie ergänzt den Klassenunterricht durch
praktisch-sinnliche Arbeit vor Ort: Konfrontation der [Schüler]
mit der Komplexität der soz. Welt (z.B. Orientierung,
Kartierung, Interview, Beobachtung) u. der Natur (z.B.
Erkundung, Beobachtung, Messung). Die Exkursion ist ein
Element von Projektunt. (Vorhaben), der vom Problemhorizont
der Kinder ausgeht. Begegnung mit Menschen [...] können soz.
Sensibilität und Natur-Schonung fördern. Durch Eigentätigkeit
u. entdeckendes Lernen werden theoretische und ästhetische
Formen des Denkens zueinander in Beziehung gesetzt.“
„Die Erkundung eines Ortes soll eine gezielte
Auseinandersetzung der Schüler mit der gebauten Umwelt und
ihren Rahmenbedingungen sein. Die Klasse muß zwangsläufig in
Gruppen arbeiten, lernt das beharrliche, zielgerichtete,
inhaltlich stimmige Sich-Informieren. Geographische Aspekte
werden im Vordergrund stehen, doch fließen auch
geschichtliche, sozial- und wirtschaftskundliche, ja sogar
kunsthistorische Fakten mit ein.“
Das Angebot
an Themenbereichen und Vorschlägen zu Exkursionen im
Geschichtsunterricht, aber auch zu Exkursionen allgemein ist
nicht besonders reichhaltig. Zum einen liegt dies sicherlich
daran, dass Exkursionen ortsnah durchgeführt werden sollten,
womit die Möglichkeiten de facto unerschöpflich sind. Zum
anderen kann es auch daran liegen, dass es nicht ohne
Schwierigkeiten ist, eine Exkursion im Schulalltag durchzuführen.
Oft hindert das sehr starre Unterrichts- und Stundenkonzept.
Selten gibt es für Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit,
Stunden abzugeben, da sie natürlich zunächst ihr eigenes
Plansoll erfüllen müssen und deshalb die Unterrichtszeit für
sie sehr wertvoll ist. Ein weiteres großes Problem liegt in
der versicherungstechnischen
Absicherung: je nach Bundesland und Schulform müssen über
zahlreiche Instanzen Absicherungen getroffen werden, die zwar
nötig und wichtig sind, jedoch auch immer einen erheblichen bürokratischen
Aufwand darstellen, den sicher nicht wenige Unterrichtende
scheuen. Oft ist eine Finanzierung unklar. Nicht alle Schüler,
nicht alle Eltern sind bereit oder in der Lage, notwendige
Mittel aufzubringen.
Sind diese
Punkt geklärt, bleibt ein weiterer sicherlich wichtiger Punkt
ist das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer: ist sich
einen Lehrer des Verhaltens seiner Schutzbefohlenen unsicher,
so wird er nicht davon ausgehen, mit Leichtigkeit seiner
Aufsichts - und Fürsorgepflicht über oft mehr als 25 oder 30
Schülern in eventuell unübersichtlichen Gegenden mit
nachzukommen.
Und doch
lassen sich gerade diese letzten Hindernisse nehmen. Eventuell
kann ein Kollege einbezogen werden, der ein verwandtes Fach
unterrichtet und sich so in die Exkursion einbringen kann.
Ebenso hat der Autor die Erfahrung gemacht, dass Eltern sehr
interessiert reagieren können, wenn sie direkt angesprochen
werden und so Einblick in den Unterricht erhalten.
Wichtig
ist es, von Anfang an die Schülern zur Selbsttätigkeit und
zum selbständigen Arbeiten anzuregen.
Die einzelnen Aufgeben der Dokumentation während der
Exkursion sollen möglichst frei angelegt sein, die Schüler
sollen möglichst gemäß ihrer Neigungen und Fähigkeiten
arbeiten. So bietet die Exkursion den Rahmen, in dem sich die
Schüler entfalten, der Lehrer übernimmt nach einer Einführung
möglichst die Rolle des Beobachtenden, des Kommentierenden,
nicht die des Vorschreibenden.
Dieses Prinzip sollte in der Einheit möglichst bald nach der
Einführung durch den Lehrer übernommen werden.
Festgehalten
werden soll an der klassischen Einteilung von Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung.
In einer
ersten einführenden Stunde nennt der Lehrer das Thema und
stellt mittels kurzem Lehrervortrag die Unterrichtseinheit
vor. Hierbei geht es hauptsächlich im die am Anfang der
Sachdarstellung genannten Entwicklungen der Stadt seit dem
Mittelalter um die Schüler kurz in den Bereich einzuführen.
Es sollen hier nur stichpunktartig einige Sätze fallen, um
die Klasse in das Thema und sein Vokabular einzuführen.
Ausgangsfrage für die Stunde ist: Wie entwickelte sich das
Wohnen und die Wohnumgebung der Menschen in der Geschichte?
Hiermit soll
das Vorwissen der Schüler abgefragt werden. Sicherlich haben
die Schüler aus verschiedenen Lebensbereichen, aber auch aus
dem Fach Geschichte und anderen Fächern wie Deutsch oder auch
Geographie bereits einiges über diesen Themenbereich gehört.
Die Antworten werden stichwortartig von den Schülern und vom
Lehrer an der Tafel gesammelt, eventuell findet bereits eine
zeitliche Zuordnung statt.
Stichworte können
z.B. sein: Höhle, Zelt, Hütte, Haus, Bürgerhaus, Hochhaus,
Stadt, Dorf (in seinen verschiedenen Formen ) , Stadtteil,
Kiez, Wohnung, Mietskaserne, Platten Bau usw.
(10 Minuten)
Vom
Allgemeinen geht es zum Besonderen, denn anschließend sollen
die Schüler dafür sensibilisiert werden, welche diese
Begriffe sie aus eigener Anschauung kennen, welche in ihrer
direkten Umgebung vorhanden sind. Der Kreis der gefundenen
Begriffe wird zwar eingeengt, jedoch kann erwartet werden,
dass ein großer Teil in den Schülern bekannt ist. (5
Minuten)
Nun eröffnet
der Lehrer der Klasse den Plan, einzelnen Objekte in einer
Exkursion genauer zu betrachten. Hier ist erfahrungsgemäß
mit einiger Begeisterung zu rechnen. Der Lehrer regt die
Klasse an, mögliche Ziele zu diskutieren. Hierbei soll
bereits auf eine realistische Erreichbarkeit wert gelegt
werden, vor allem aber sollen die möglichen Objekte bereits
nach Möglichkeit für eine bestimmte Entwicklung beispielhaft
seien. Dies ist sicherlich ein bedenkliches vor haben, da
eventuell dieses wesentlich detaillierter Uhr Vorwissen bei
den Schülern nicht gegeben ist. Diese Unsicherheit kann durch
den Vorgabenkatalog des Lehrers ausgeräumt werden. Jetzt wählen
die Schüler ihre Ziele (15 Minuten )
Im Anschluss
daran fragt der Lehrer die Schüler nach den Notwendigkeiten für
die Exkursion, zum einen natürlich nach den Utensilien für
eine Exkursion, wie Verpflegung, feste Kleidung und allem, was
man brauchen könnte, wenn man eine Weile unterwegs ist, vor
allem aber danach, wie diese Betrachtung stattfinden und
dokumentiert werden soll. Schließlich soll in der folgenden
Stunde einer Auswertung stattfinden. Schüler ordnen sich je
nach Neigung Gruppen zu, die Beschreibungen anfertigen,
fotografieren, skizzieren, eventuell Bewohner oder Anwohner
befragen usw. Selbstverständlich trägt sehr Lehrer dafür
Sorge, dass alle Gruppen ausreichend besetzt sind (10 Minuten)
Die
eigentliche Wege Planungen werden vom Lehrer vorgenommen, so
dass er die grob Planung dazu, sowie eine kurze
Zusammenfassung der Stunde und einen Ausblick auf die
Exkursion zum Abschluss vornehmen kann und so die Schüler für
die Stunde end lässt. (5)
Hier kann kein genauer Ablauf,
kein exakter Fahrplan vorgestellt werden, da dieser natürlich
von der Wahl der Schüler und vom Standort der Schule abfängt.
Ein Beispiel für die Exkursionsorte Hufeisensiedlung und
Falkenberg und einer gedachten Schule in Berlin - Mitte könnte evtl.
wie folgt aussehen:
- Fahrt von
der Schule zur Hufeisensiedlung U8 / U7
- ca. 30 Minuten
Die
Hufeisensiedlung liegt ca. 10 Gehminuten vom U-Bahnhof
Parchimer Allee entfernt
- Rundgang
vor Ort, selbstständige Arbeit der Schüler
- 40
Minuten
Die Schüler
dokumentieren den Bau, das Umfeld usw.
mit den von ihnen gewählten Mitteln
- Fahrt von
der Hufeisen Siedlung nach Falkenberg
mit U- und S-Bahn
- ca. 30 Minuten - Falkenberg liegt ca. 10 Gehminuten von
den S-Bahnhöfen Alt-Glienicke und Grünau entfernt
- Rundgang
vor Ort, selbstständige Arbeit der Schüler
- 40
Minuten
Auch hier
dokumentieren die Schüler die Bauten, das Wohnumfeld, usw.
mit den von ihnen gewählten Mitteln, führen evtl. Gespräche
mit Bewohnern
- Fahrt von
Falkenberg zur
Schule -
ca. 30 Minuten
Es ergibt
sich eine geplante Gesamtdauer von 3 Stunden 10 Minuten. Evtl.
ist je nach Befindlichkeit der Schüler eine weitere Pause
einzurechnen, so dass die Abwesenheit von der Schule mit ca. 3
½ Stunden zu veranschlagen ist.
Zum Abschluss
der Exkursion gibt der Lehrer als Hausaufgabe zur kommenden
Stunde die Aufbereitung der Ergebnisse zu einer präsentierfähigen
Arbeit.
In der
Zwischenzeit haben die Schüler die Ergebnisse der Exkursion
vorliegen, Berichte sind geschrieben, Fotos sind entwickelt,
Skizzen sind gezeichnet, Interviews geschnitten und
zusammengefasst. In dieser Stunde soll es darum gehen, die
Ergebnisse der einzelnen Gruppen der gesamten Klasse
vorzustellen. Der Zeitrahmen dafür soll recht offen gehalten
werden, da die Präsentation unterschiedlich lang sein werden.
Vor allem kommt es darauf an, dass die unterschiedlichen
Sichtweisen, unterschiedlichen Betrachtungen der einzelnen
Gruppen den anderen Schülern vermittelt werden, so dass alle
ein Gesamtbild bekommen. Hierdurch ist eine möglichst breite
Palette an Dokumentationen entstanden. Die Schüler können
selbst entscheiden, ob sie diese Ergebnisse, ihre Arbeiten,
einer breiteren Öffentlichkeit mittels einer Ausstellung im
Schulgebäude oder auch mit einer PowerPoint Präsentation zugänglich
machen wollen.
-
Das
Hufeisen in Neukölln, Berlin (o.J.)
-
DEUTSCHE
GARTENSTADTBEWEGUNG (1902 und 1907): Programm (Faks.). - In:
Im Grünen wohnen - im Blauen planen. Ein Lesebuch zur
Gartenstadt. BOLLEREY, F./G. FEHL/K. HARTMANN (Hrsg.), Hamburg
1990 S. 102-105.
-
FEHL,
G. (o.J.): Berlin wird Weltstadt: Wohnungsnot und
Villenkolonien - Eine Begegnung mit Julius Faucher, seinem
Filter-Modell und seiner Wohnungsreform-Bewegung um 1866 - In
: Von Licht, Luft und Ordnung in der Stadt der Gründerzeit. -
(Städtebaureform 1865-1900, Teil 1). RODRIGUEZ-LORES, J./G.
FEHL (Hrsg.), Hamburg 1985, S. 101-153.
-
FELDMEIER/GIGL/KLEBER/MUSSELMANN/RATTELSDORFER
: Abiturtraining - Grundkurs Geschichte.-4. aktualisierte
Aufl., Freising 1993
-
HARTMANN,
K., Deutsche Gartenstadtbewegung - Kulturpolitik und
Gesellschaftsform. - München 1976
-
HEINEBERG,
H., Stadtgeographie- (Grundriß allgemeine Geographie, Teil X)
Paderborn/München/Wien/Zürich 1989
-
HOFMEISTER,
B. (o.J.), Alt-Berlin - Groß-Berlin - West-Berlin. Versuch
einer Flächennutzungsbilanz 1786-1985. - In: Berlin. Beiträge
zur Geographie eines Großstadtraumes. Festschrift zum 45.
Deutschen Geographentag in Berlin vom 30.9.1985 bis 2.10.1985.
HOFMEISTER, B./ H.-J. PACHUR/C. PAPE/G. REINDKE (Hrsg.),
Berlin 1985, S. 251-275
-
Knirsch, R.: Die Erkundungswanderung. Paderborn 1979
-
KRABBE,
W.R., Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, 1989 Göttingen
-
LESER,
H (Hrsg.), Diercke - Wörterbuch Allgemeine Geographie. München 1997
-
REINBORN,
D (1996): Städtebau im 19. und 20. Jahrhundert. -
Stuttgart/Berlin/Köln.
-
SCHULTE-DERNE,
F., Naturraum im Wandel - Die Besiedlung des Ruhrgebietes. -
In: Die grüne Stadt. KASTORFF-VIEHMANN, R. (Hrsg.), Essen
1998, S. 17-25.
-
WERNER;
F., Zur räumlichen Entwicklung Berlins in den letzten
Jahrzehnten. - In: Berlin. Beiträge zur Geographie eines Großstadtraumes.
Festschrift zum 45. Deutschen Geographentag in Berlin vom
30.9.1985 bis 2.10.1985. HOFMEISTER, B./ H.-J. PACHUR/C.
PAPE/G. REINDKE (Hrsg.) Berlin 1985, S. 223-243.
-
www.isl.uni-karlsruhe.de
-
www.broehan-museum.de/jugendstil.htm
-
www.schwarzaufweiss.de/Prag/wasistjugendstil.htm

vgl.
REINBORN1996, S. 46.
www.archINFORM.de/arch/2692.htm
vgl. Knirsch, R.: Die
Erkundungswanderung. Paderborn 1979
